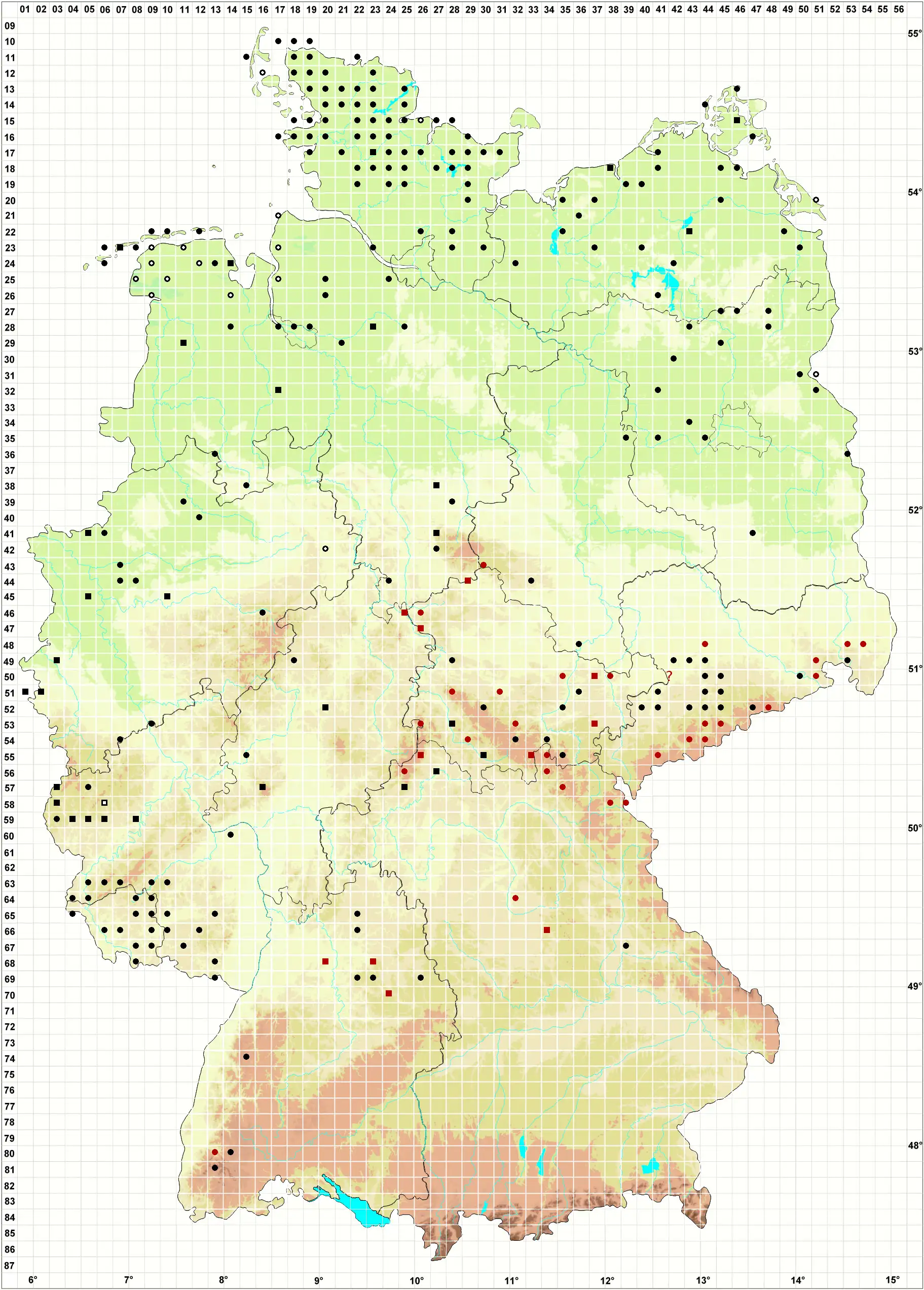In unserer Datenbank gibt es 15 Datensätze .
Bitte klicken Sie die Karte für Details. [ Verbreitung in Deutschland ]
[ Verbreitung in Deutschland ]
Fertilität
Höhenverteilung
Beschreibung der Art
Habitat/Ökologie (Meinunger & Schröder 2007)
Verbreitung (Meinunger & Schröder 2007)
Bestand und Gefährdung (Meinunger & Schröder 2007)
Verwandte Arten
- → Orthotrichum abbreviatum Grönvall
- → Orthotrichum acuminatum H.Philib.
- → Orthotrichum affine Brid.
- → Orthotrichum affine Brid. var. affine
- → Orthotrichum affine subsp. fastigiatum (Bruch ex Brid.) Hartm.
- → Orthotrichum alpestre Hornsch. ex Bruch & Schimp.
- → Orthotrichum anomalum Hedw.
- → Orthotrichum arnellii Grönvall
- → Orthotrichum australe Jur.
- → Orthotrichum braunii Bruch & Schimp.
- → Orthotrichum callistomum Fisch.-Oost. ex Bruch & Schimp.
- → Orthotrichum coarctatum P.Beauv.
- → Orthotrichum columbicum Mitt.
- → Orthotrichum consimile Mitt.
- → Orthotrichum creticum Baumgartner
- → Orthotrichum crispum Hedw.
- → Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid.
- → Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid. var. cupulatum
- → Orthotrichum cupulatum var. nudum (Dicks.) Lindb.
- → Orthotrichum cupulatum var. riparium Huebener
- → Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.
- → Orthotrichum drummondii Hook. & Grev.
- → Orthotrichum elegans auct. eur. non Schwägr.
- → Orthotrichum fallax Bruch ex Brid.
- → Orthotrichum fastigiatum Bruch ex Brid.
- → Orthotrichum franzonianum De Not. ex Venturi
- → Orthotrichum gymnostomum Bruch ex Brid.
- → Orthotrichum hutchinsiae Sm.
- → Orthotrichum killiasii Müll.Hal.
- → Orthotrichum leiocarpum Bruch & Schimp.
- → Orthotrichum leucomitrium Bruch & Schimp.
- → Orthotrichum lewinskyae F. Lara, Garilleti & Mazimpaka
- → Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor
- → Orthotrichum macroblephare Schimp.
- → Orthotrichum obscurum Grönvall
- → Orthotrichum obtusifolium Brid.
- → Orthotrichum octoblephare Brid.
- → Orthotrichum pallens Bruch ex Brid.
- → Orthotrichum pallidum Grönvall
- → Orthotrichum paradoxum Grönvall
- → Orthotrichum patens Bruch ex Brid.
- → Orthotrichum perforatum Limpr.
- → Orthotrichum polare Lindb.
- → Orthotrichum pulchellum var. winteri (Schimp.) Braithw.
- → Orthotrichum pumilum Sw.
- → Orthotrichum rivulare Turner
- → Orthotrichum rogeri Brid.
- → Orthotrichum rogeri var. defluens (Venturi) Venturi
- → Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr.
- → Orthotrichum sardagnanum Venturi
- → Orthotrichum saxatile Brid.
- → Orthotrichum scanicum Grönvall
- → Orthotrichum schimperi Hammar
- → Orthotrichum schubartianum Lorentz
- → Orthotrichum shawii Wilson
- → Orthotrichum speciosum Nees
- → Orthotrichum speciosum Nees var. speciosum
- → Orthotrichum splachnoides Froel. ex Brid.
- → Orthotrichum sprucei Mont.
- → Orthotrichum stellatum Brid.
- → Orthotrichum stramineum Hornsch. ex Brid.
- → Orthotrichum stramineum var. patens (Brid.) Venturi
- → Orthotrichum striatum Hedw.
- → Orthotrichum sturmii Hoppe & Hornsch.
- → Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid.
- → Orthotrichum urnigerum Myrin
- → Orthotrichum venturii De Not.
- → Orthotrichum winteri Schimp.